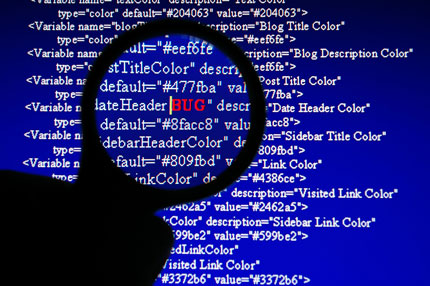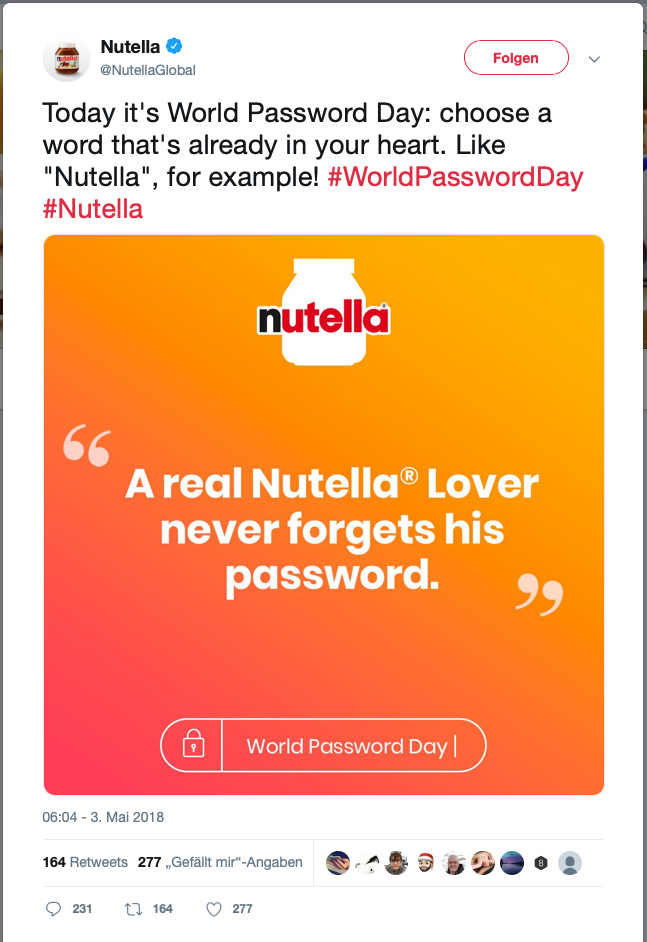Wird Jackson-Databind als 3rd-Party-Lib in einem Projekt eingebunden, oder es ist über eine transitive Abhängigkeit mit im Projekt, dann melden Analysetools umgehend ein Finding. Aber in welchem Fall ist Jackson-Databind tatsächlich gefährlich?
Hintergrund
Jackson-Databind wird verwendet, wenn Json Strings deserialisiert werden. Die Deserialisierung ist etwas komplizierter als die Serialisierung, was daran liegt, dass beim Serialisieren die Klassen noch bekannt sind. Werden abstrakte Klassen oder Interfaces verwendet, ist das beim Serialisieren egal – der Json String ist immer der gleiche. Anders herum muss beim Deserialisieren, wenn der Json String wieder in reale Objekte gemappt wird, eine Entscheidung für konktete Klassen gefällt werden, die auch instantiiert werden können.
Damit Jackson bei der Deserialisierung konkrete Klassen ermitteln kann, wird mit Annotations gearbeitet, über die die Klassen angegeben werden können:
{ "phone" : {
"@class" : "package.InternationalNumber",
"areaCode" : 555,
...
}
}
Auf Seite der Java-Klasse wird als Gegenstück z.B. mit @JsonTypeInfo gearbeitet, damit Jackson die richtige Klasse findet. Es gibt hier eine Vielzahl an Annotations, die bei komplexeren Strukturen helfen sollen.
Die Gefahr
Die Sicherheitslücke besteht dann, wenn der Json String so manipuliert werden kann, dass bei der Deserialisierung eine Klasse instanziiert wird, die Schaden anrichten kann (Denial of Service, Sensitive Data Exposure, Data Manipulation, …). Solche Klassen werden in diesem Kontext als „Gadgets“ bezeichnet.
Eine Gadget-Klasse muss allerdings im Klassenpfad der Anwendung liegen, weshalb zunächst unlogisch erscheint, dass damit Schaden angerichtet werden kann. Es gibt aber verschiedene polymorphe Klassen, über die generischer Code eingeschleust werden kann, der dann zur Ausführung kommt. Jackson hat deshalb bereits eine Blacklist an bekannten Gadget-Klassen, die bei der Deserialisierung nicht ausgeführt werden. Allerdings kommen immer neue kreative Varianten dazu, so dass naturgemäß eine Blacklist kein vollkommener Schutz sein kann.
Voraussetzungen für erfolgreichen Angriff
- Die Anwendung akzeptiert Json von Clients, das manipuliert werden kann.
- Bei der Kommunikation zwischen 2 Anwendungen, die sich in einer Trustzone befinden, sollte diese Gefahr nicht gross sein, da darauf vertraut wird, dass keine bösartigen und manipulierten Json Strings verwendet werden.
- Wurde die Trustzone allerdings kompomittiert, dann fällt dieses Argument, so dass man auch bei interner Kommunikation weitere Maßnahmen vorsehen sollte.
- Die Anwendung beinhaltet im Classpath mindestens 1 Gadget-Klasse, mit der ein Angriff ausgeführt werden kann.
- Da in einer Anwendung meist sehr viele Klassen über transitive Abhängigkeiten enthalten sind, sind auch viele bekannte Gadget-Klassen verfügbar. Selbst im JDK existieren Klassen, die als Gadgets missbraucht werden können.
- Aus diesem Grund trifft auch diese Voraussetzung streng genommen immer zu.
- Die Anwendung hat aktives polymorphes Typehandling für Felder mit dem Type Object aktiviert (oder andere allgemeine Typen wir Serializable, Comparable, …)
- Dies wird im Code über die Methode org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper.enableDefaultTyping() aktiviert
- Die Anwendung verwendet Jackson-Databind in einer Version, die (noch) keine fragwürdige Gadget-Klassen blockiert via Blacklisting.
- Ist die Jackson-Version aktuell, dann ist es sehr schwer, aber nicht ausgeschlossen, Gadget-Klassen zu finden, die einen Angriff zulassen.
- Ist die Jackson-Version aktuell, dann ist es sehr schwer, aber nicht ausgeschlossen, Gadget-Klassen zu finden, die einen Angriff zulassen.
Da (1) und (2) nie komplett ausgeschlossen werden können, sollten wir uns auf (3) und (4) fokussieren.
Folgendes ist noch festzustellen für die beiden Ausprägungen:
- Polymorphie: Anhand des Parameters
valueTypewird über die AnnotationJsonTypeInfodefiniert, welche „Zielklasse“ bei der Deserialisierung verwendet werden soll. Das ist entweder diese übergebene KlassevalueTypeselbst oder wird wiederum durch Annotationen dieser Klasse bestimmt. Durch die AnnotationJsonTypeInfokann definiert werden, dass die tätsächlich instanzierte Klasse, durch einen Parameter innerhalb des JSON-Textes vorgegeben wird, was bedeutet, dass der Sender des JSON-Textes die Entscheidung trifft. Die Entscheidung ist nicht völlig frei: die instanzierte Klasse, muss eine Erweiterung der KlassevalueTypesein. Jackson bietet dazu mehrere Möglichkeiten. Die Kritische ist die, bei der Klassenname, bzw. ein Teil des Klassennamens, als JSON-Inhalt definiert/ausgewertet wird. - DefaultTyping: unbestimmte/generische Attribute – beispielsweise von Type Tattr
Object– können bei eingeschaltetem DefaultTyping mit Objekten befüllt werden, deren konkreter Typ Tconc durch den JSON-Inhalt bestimmt wird. Im Falle des Attributstyps Tattr Object unterliegt Tconc lediglich der Einschränkung, dass Tconc im Klassenpfad zu finden sein muss.
Ein Beispiel für eine gefährliche Codestelle ist folgende:
public class Person {
@JsonTypeInfo(use = Id.CLASS)
public Object phone;
}
Hier wird über @JsonTypeInfo der Klassenname angegeben, so dass dieser in der Json Struktur über die @class Annotation angegeben werden kann. Ist DefaultTyping aktiviert, dann kann an Stelle des Typs Object eine Gadget-Klasse treten, die der Angreifer angibt.
Prävention
- Immer die neueste Jackson-Databind Version verwenden
- denn diese enthält die vollständigste Liste der gefährlichen Gadget-Klassen in der Blacklist
- das ist kein perfekter Schutz, aber das mindeste was man tun sollte
- Default Typing vermeiden
- statt dessen explizit die Klassen angeben, die bei der Deserialisierung verwendet werden sollen
- Allgemeine Klassen wie Object, Serializable, … vermeiden in den Objekten, die übertragen werden
- dadurch wird vermieden, dass beliebige Klassen für den Angriff verwendet werden können
- Möglichst „type name“ verwenden und nicht classname als Type-Id
- @JsonTypeInfo(use = Id.NAME) anstatt @JsonTypeInfo(use = Id.CLASS)
- @JsonTypeInfo(use = Id.NAME) anstatt @JsonTypeInfo(use = Id.CLASS)